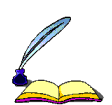

| Dinslakener Geschichte 1945 |
|
 |
|
|
|
|
Das Ende des Krieges vor Augen, erleben die Dinslakener den schwärzesten Tag in der Stadtgeschichte: Am 23. März 1945 starten gegen 8:00 Uhr morgens über hundert Maschinen der 9. US-Luftflotte von fünf Flugplätzen in Nordfrankreich mit Kurs auf Dinslaken. Die zweimotorigen Bomber Typs Martin B-26 "Marauder" konnten eine Bombenlast von über zwei Tonnen mitführen. Die leichteren Douglas A-20 "Havoc" und Douglas A-26 "Invader" hatten geringere Kapazitäten. Jedes Flugzeug konnte bis zu 30 Bomben verschiedener Größen tragen. Der Auftrag: Auslöschen von Verteidigungsstellungen bei Dinslaken zur Vorbereitung des Übergangs der alliierten Bodentruppen über den Rhein. Ein besonderter Auftrag galt der Zerstörung des örtlichen Walzwerks. Die Bewohner der Stadt Dinslaken, überwiegend Frauen, Kinder und ältere Männer, wurden zuvor gewarnt: Allein am 20. März waren 74.000 Flugblätter zur Ankündigung eines bevorstehenden Angriffs mit dem Aufruf zur Kapitulation über Dinslaken abgeworfen worden. |
Gegen 9:30 Uhr begann am Schwarzen Freitag das Bombardement, das in mehreren Wellen und in zwei Schichten, eine am Vormittag, eine am Nachmittag, weite Teile der Stadt dem Erdboden gleich machten. Insgesamt starben an diesem Tag 511 Menschen. Abends waren nicht nur die meisten Wohnhäuser zerstört, sondern auch beide Krankenhäuser, die meisten Kirchen, der Bahnhof und Teile des Walzwerks. Dinslaken wurde zu mehr rund 80% zerstört. Einen Tag später rücken amerikanische Truppen über den Rhein nach Dinslaken. Anfang Mai rücken die Amerikaner ab. Die nachstehenden Presseberichte sollen Einblicke in die damaligen Geschehnisse vermitteln: |
|
STADTGESCHICHTE Nur knapp dem Tod entronnen Birgit Gargitter NRZ 23.03.2012 DINSLAKEN. Es war ein heller, strahlender Frühlingstag, der die Menschen nach draußen lockte. Zwei Tage noch bis Palmsonntag. Niemand an diesem Vormittag ahnte, dass der Tag als ,,Schwarzer Freitag“ in die Geschichte der Stadt eingehen sollte. Auch Emma Schindler nicht. Die heute 94-jährige lebte damals wie heute in ihrem Haus an der Düppelstraße. Mit ihren Eltern, den zwei Kindern Manfred und Rita. „Ich wollte an diesem Tag zur Metzgerei an der Wielandstraße“, erinnert sich die alte Dame. „Mit meinen Nachbarn bin ich morgens losspaziert. Sie wollten zum Amt und ich sollte mitkommen. Doch ein unbestimmtes Gefühl hielt mich davon ab“, erzählt Emma Schindler weiter. Ein Gefühl, das ihr das Leben retten sollte. Aus der Ferne waren plötzlich Flugzeuge zu hören, ein normaler Vorgang zu jener Zeit, zumal die Warnung ausblieb. Die Nachbarn gingen weiter. Und dann waren die Amerikaner da „Plötzich fielen überall Bomben. Detonation auf Detonation.“ Angst ergriff die damals junge Frau, Angst um ihr Leben, um das Schicksal der Familie, der Kinder. Sie lief die Hünxer Straße zurük, den ohrenbetäubenden Lärm hinter sich, über sich die den Tod abwerfenden Flugzeuge. Immer wieder warf sie sich auf die Erde, versteckte sich, hoffte, dass die Piloten sie nicht bemerken. Einmal habe sie sich in einen Garten geschmissen, dort Schutz gesucht. „Dabei habe ich meine Einkaufstasche mit all meinem Geld verloren“, berichtet Emma Schindler. Doch das habe sie damals kaum bemerkt. In ihr war nur der Gedanke, zu ihren Kindern zu gelangen und sich mit ihnen in Sicherheit zu bringen. Emma Schindler schaffte es schließlich mit vielen Unterbrechungen, zu ihrem Haus an der Düppelstraße zu gelangen. Die Mutter und die Kinder waren langst im Bunker an der Viehhalle (heute Pintsch Bamag) untergekommen. „Ich war kaum in Sicherheit, da fielen auch bei uns die Bomben.“ Ihr Haus an der Düppelstraße war getroffen. Doch sie und ihre Kinder überlebten das Inferno; zwei ihrer Nachbarinnen, Martha und Hedwig, mit denen sie in Richtung Stadt gezogen war, fanden an diesem 23. März den Tod. |
Die 91-jährige Emma Schindler ist Zeitzeugin des ,,Schwarzen Freitags“, dem Tag der Bombardierung Dinslakens während des 2. Weltkrieges. Foto: Heiko Kempken Zwei Tage später kamen die Amerikaner an der Düppelstraße an, besetzten das Haus. „Die Waren nett und versorgten uns mit Lebensmittel“, erinnert sich Emma Schindler. Vor allem das blond gelockte Töchterchen hatten die GI’s ins Herz geschlossen, die die Kleine mit Schokolade verwöhnten. Nur die Wertsachen und vor allem die Nahmaschine musste die Hauseigentümerin verstecken. „Keine Ahnung warum, aber auf Nähmaschinen waren die Amerikaner ganz scharf. Ich hatte bei einer Nacht- und Nebelaktion meine alte Maschine auf dem großen Grundstück versteckt. Die paar Wertsachen, die ich besaß vergrub ich im Kohlenkeller.“ Das Glück blieb Emma Schindler und ihrer Familie hold: Die Alleinerziehende kam als Köchin beim amerikanischen Stadtkommandanten, „ein netter Mann“, in der alten Villa von Julius Kalle, Direktor des Walzwerkes, unter. Hintergrund: 800 Tonnen Brand- und Sprengbomben fielen an jenem 23. März 1945, dem „Schwarzen Freitag“, auf Dinslaken. 511 Menschen fanden dabei den Tod. Mittelschwere und leichte Bomber der 9. Bomberdivision hatten den ‘“Verkehrsknotenpunkt Dinslaken“ brennend hinterlassen. Die feindliche Verteidigung sollte so für den alliierten Angriff geschwächt werden. |
|
Als die Voerder Rheindörfer unter Beschuss standen Birgit Gargitter, NRZ 24.03.2020
Die Amerikaner bei der Rheinüberquerung 1945 zwischen Wallach und Ork.- Foto(1): Privat Voerde: In der letzten Märzwoche 1945 querten die Alliierten den Rhein. Die Bevölkerung hatte zuvor bereits unter verstärkten Bombenangriffen gelitten. In der letzten Märzwoche vor 75 Jahren endete für die Voerder und auch für die Dinslakener Bevölkerung faktisch der Zweite Weltkrieg, dessen Ende in Europa mit der Kapitulation der Deutschen am 8. Mai offiziell besiegelt wurde. Monate zuvor bereits litt auch die Bevölkerung am Niederrhein unter verstärkten Bombenangriffen. Heute ist bekannt, dass die Bombardierung Dinslakens am 23. März 1945 und der Artilleriebeschuss unter anderem auf die Voerder Rheindörfer nur ein Ziel hatten: die Vorbereitung des Rheinübergangs. Der Übermacht der Alliierten stand auf deutscher Seite nur eine zahlenmäßig kleine und geschwächte Verteidigungsgruppe gegenüber. Am 9. März hatte Feldmarschall Bernard Law Montgomery seine ersten Anweisungen für den Rheinübergang herausgegeben und den 23. März als ersten Angriffstag festgesetzt. Eine nicht gerade leichte Aufgabe, denn „der Rhein war ein schreckliches militärisches Hindernis, besonders was seine nördlichsten Teile angeht“, schrieb der damalige Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte und spätere Präsident der Vereinigten Staaten, Dwight D. Eisenhower, in seinem Buch „Kreuzzug in Europa“. Eine sorgfältige Vorbereitung erfolgte in den Wochen vor dem Übergang. Für Eisenhower stellte die Rheinüberquerung die größte und schwierigste Operation seit der Landung an der Küste der Normandie dar. Lange vor der Invasion hatten Soldaten an Flüssen in Großbritannien umfassende Versuche angestellt, um herauszufinden, welche Art von Landungsbooten am geeignetesten wären und welche Lasten sie befördern könnten. Kurz vor dem Angriff wurde selbst an der Maas in den Niederlanden noch geübt. |
Granate fegte Zwiebelturm von Haus Wohnung hinweg Zu einer letzten Besprechung trafen sich Montgomery, Eisenhower und der britische Premierminister Winston Churchill in Walbeck. Man schrieb den 15. März 1945, der Angriff sollte in der Nacht zum 24. März geschehen. Von all den Vorbereitungen ahnten die Volkssturmleute und Fallschirmjäger in Walsum, Götterswickerhamm und Mehrum nichts. Sehen konnten sie ebenfalls nicht, was am anderen Ufer vor sich ging. Wenn jedoch einmal die künstliche Nebelwand aufriss, konnte man schon mit bloßem Auge seltsame Fahrzeuge und große Munitionsstapel am anderen Ufer erkennen. Einer der Beobachtungsposten, Peter R., konnte die Abschüsse der Artillerie beobachten, wie der verstorbene Dinslakener Heimatforscher Willi Dittgen in seinem Buch „Der Übergang“ schrieb. Peter R. saß in einer Turmluke von Haus Wohnung in Möllen. Als die ersten Geschosse an seinem Beobachtungsposten vorbeiflogen, verließ er schnurstracks seinen Posten. Nur wenige Augenblicke später fegte eine andere Granate den Zwiebelturm hinweg. Weitere Treffer beschädigten Haus Wohnung, später auch Haus Ahr erheblich. Um 2 Uhr nachts, oder anders ausgedrückt, in den frühen Nachtstunden des 24. März, stieg in der Höhe von Mehrum die 30. Division der Amerikaner mit einem Filmteam in die Boote. Schütze Malcolm B. Buchanan war einer von ihnen. „Ich hoffte nur, lebend aus der ganzen Sache herauszukommen“, gestand er später. Ein Mann vom Filmteam soll ihn getröstet haben: „Schau mal, Du wirst der erste Mann sein, der das Ufer betritt.“ Nicht wirklich ein beruhigende Gedanke für den Schützen. Und obgleich die Überfahrt nur vier Minuten dauerte, erschien es ihm, wie er später sagte, wie eine Stunde. Info: Rheinfähre stellte am 5. März den Betrieb ein Bereits am Montag, 5. März 1945, hatte gegen Mittag die Rheinfähre Walsum-Orsoy den Betrieb eingestellt, als amerikanische Panzer am Westrand von Orsoy erschienen. Tag und Nacht hatte man zuvor flüchtende Soldaten und Zivilisten vom linken Rheinufer herübergeholt. Immer noch tauchten letzte Versprengte am linken Rheinufer auf, versuchten verzweifelt, das rechte Ufer zu erreichen. Walsumer und Spellener unternahmen das Wagnis, diese Menschen in Sicherheit zu bringen, berichtet der verstorbene Dinslakener Heimatforscher Willi Dittgen in seinen Schriften. |
|
Vor 75 Jahren spazierte Winston Churchill am Rhein in Voerde Birgit Gargitter. NRZ 24.03.2020
Der damalige britische Premierminister Winston Churchill – typisch mit Zigarre – bei der Rheinüberquerung 1945 am Niederrhein. - Foto: Privat Wo Winston Churchill und Generalfeldmarschall Montgomery vor 75 Jahren anlandeten, darüber gibt es in Mehrum und Spellen verschiedene Ansichten. Es war die Nacht zum 24. März 1945, als die alliierten Kräfte den Rhein bei Mehrum überquerten. Um genau 2 Uhr stiegen die ersten Truppen in die Boote und machten sich auf ans rechte Ufer. Auf Widerstand der Deutschen stießen sie dabei kaum. 75 Jahre sind seit diesem Tag vergangen. Clinton B. Conger begleitete die Operation Flashpoint (Teil der Operation Plunder) als Korrespondent der „United Press“. Er war dabei, als die amerikanischen Soldaten immer weiter vorstießen, den Rhein überquerten und ihren Marsch Richtung Berlin aufnahmen. „Wir begannen mit dem Übergang um 2 Uhr morgens“, berichtete er. „In den Stunden vor dem Übergang waren die deutschen Stellungen dem furchtbarsten Trommelfeuer der Artillerie, das in diesem Weltkrieg je zugange war, ausgesetzt. Die Befestigungen des Feindes wurden zertrümmert. Als wir jedoch über den Rhein fuhren, herrschte eine Todesstille. Nur das leise Plätschern des Wassers gegen die Seiten unseres Bootes konnte gehört werden.“ Nur wenige Bewohner hatten nach dem ersten Granateneinschlag im Dorf ausgeharrt Bereits um 2.30 Uhr tauchten die ersten Amerikaner in Mehrum auf. Das bestätigen Aussagen der wenigen Dorfbewohner, die noch im kleinen Ort ausgeharrt hatten. Die anderen hatten, so der verstorbene Heimatforscher Willi Hüser, bereits beim ersten Granateneinschlag am 3. März den Ort verlassen. Auch Willi Hüser, damals zwölf Jahre alt, befand sich unter den Flüchtenden. „Beim Artilleriebeschuss zur Vorbereitung des Rheinübergangs gingen damals ein Drittel der Häuser in Flammen auf“, erzählte Hüser vor wenigen Jahren der NRZ. Der Abschnitt von Wesel bis Walsum, also auch der Übergang bei Mehrum, gehörte zur Hauptkampflinie Rhein, so Hüser.
Ein unweit des Deichs aufgestellter Gedenkstein mit Tafel erinnert an den Rheinübergang der Alliierten vor 75 Jahren. Foto: Heiko Kempken |
Für die gesamte Operation Plunder waren dem britischen Generalfeldmarschall Bernard Law Montgomery 29 Divisionen und sieben selbstständige Brigaden unterstellt. Hinzu kamen zwei Luftlandedivisionen. In Mehrum angekommen, durchsuchten die amerikanischen Soldaten die Häuser und Höfe des Dorfes. Die wenigen verbliebenen Bewohner sowie die gefangenen deutschen Soldaten wurden abgeführt und per Boot und Lkw nach Rheinberg gebracht. Erst vier Wochen später sollten die Mehrumer wieder nach Hause kommen. Es dauerte nicht lange, dann waren auch die amerikanischen Pioniereinheiten da, die in kurzer Zeit zwei Schiffsbrücken bei Mehrum, eine weitere bei Eppinghoven und eine andere in der Nähe der Walsumer Fähre über den Rhein schlugen. Nun konnten die Alliierten ungestört Bataillon auf Bataillon und vor allem schwere Panzer in endlosen Kolonnen über den Rhein in den Brückenkopf zwischen Lippe und Emscher heranführen. Von diesen Geschehnissen ist in den Memoiren des Generalfeldmarschalls Montgomery zu lesen. In Götterswickerhamm ließen sich die Amerikaner erst gegen Mittag des 24. März blicken. Elisabeth Zobel-Bernds, damals gerade vier Jahre alt, erinnert sich, an jenem Tag den „ersten Neger“ ihres Lebens gesehen zu haben. „Heute sagt man ja politisch korrekt Afroamerikaner, aber damals...“, erzählt sie. Der Soldat war recht nett zu dem kleinen blonden Mädchen gewesen, bot ihm ein Stück Schokolade an, wenn es ihm ihren Namen verriet. „Das tat ich nicht“, berichtet Zobel-Bernds. Doch nicht etwa, weil sie stur war, nein, sie hatte als Vierjährige Schwierigkeiten, den Namen Elisabeth richtig auszusprechen. Ob sie die Schokolade trotzdem bekam, daran kann sie sich heute nicht mehr erinnern. An einem Ereignis aus Kriegstagen reiben sich auch heute noch, 75 Jahre danach, die Spellener und Mehrumer: Landeten Winston Churchill und Generalfeldmarschall Montgomery nun in Mehrum oder in Spellen? Willi Hüser verortete den Besuch der beiden in Mehrum, Winston Churchill hingegen beschreibt in seinen Memoiren die Situation folgendermaßen: Als er von seinem Stützpunkt, der Gaststätte „Wacht am Rhein“ am linken Rheinufer in Wesel-Büderich, ein anlegendes Infanterieboot erblickt hatte, sei ihm die grandiose Idee gekommen, dem gegenüberliegenden Ufer in Spellen einen Besuch abzustatten. Eisenhower soll über den Ausflug nicht amüsiert gewesen sein Er wandte sich damit an Montgomery, der erwiderte: „Warum nicht.“ Churchill sei einen Moment überrascht gewesen, zog einige Erkundigungen ein, dann setzten er und Montgomery mit drei oder vier amerikanischen Generälen und einem halben Dutzend amerikanischer Soldaten über den Rhein. Churchill soll dort bei schönem Wetter und vollkommen unbehelligt eine halbe Stunde herumspaziert sein. Und Premierminister Winston Churchill, Politiker, Soldat und Journalist, ist sich sicher, das war an der Gest bei Spellen. Und er muss es schließlich gewusst haben. Eisenhower soll übrigens nicht gerade amüsiert über diesen Ausflug gewesen sein.
|
|
Die letzten Monate des Krieges in Dinslaken NRZ 28.03.2020
Mehrfach fielen im Jahre 1945 Bomben auf Dinslaken. Den verheerendsten Angriff gab es am 23. März 1945. Foto: Heiko Kempken Zur Vorbereitung der Rheinquerung flogen die Alliierten Bombenangriffe auf Dinslaken. Im Januar 1945 wurden in Lohberg Häuser zerstört. Es war der Abend des letzten Tages des Jahres 1944. Immer wieder hörte man aus der nahen Ferne das Dröhnen der Flugzeugmotoren, doch noch war im Dinslakener Bruch alles friedlich. Jan de Vreeze saß mit seiner Frau Paula, Tochter Marianne und den Enkelkindern, der zehnjährigen Inge, dem vierjährigen Franz, die zweijährige Roswitha sowie einem Arbeitskollegen am Essenstisch bei Kartoffelsalat und Würstchen. „Mein Großvater hatte den Kollegen eingeladen, damit dieser endlich mal einen schönen Tag ohne Granatenbewurf und Artilleriebeschuss verleben konnte“, erzählt die inzwischen 85-jährige Inge. Kampfbomber überflogen Dinslaken Wovon die Familie und der Freud nichts wussten – alliierte Kampfbomber flogen einen Großluftangriff auf das benachbarte Oberhausen, unter anderem auf den Verschiebebahnhof Osterfeld. Von weitem waren am Himmel die so genannten Christbäume zu sehen, sie markierten den Angriffsraum durch Leuchtzeichen. Jan de Vreeze, wurde zunehmend unruhiger, als er die in Hiesfeld stationierte Flak hörte und den Motorenlärm heranziehender Flugzeuge. „Macht was ihr wollte, aber ich gehe in den Bunker. Ich habe ein komisches Gefühl“, sagte de Vreeze zu seiner Familie. Das Mietanwesen der de Vreezes lag inmitten von Wiesen und Kornfelder, dort wo heute die Siedlung Baßfeldshof steht. Ein Schafstall, umgebaut zum Wohnhaus mit Tenne, ein großes Gartenstück dabei, Ställe für Schwein, Schaf und Kleinvieh. Dazwischen der Erdbunker, ein zwei Meter tiefes Loch, fest geklopft mit aufgeschüttetem Wall. Ursprünglich gedacht als Vorratskammer. Kein gezielter Angriff „Noch bevor wir den Bunker erreichten, hörten wir schon die Einschläge, erzählt Enkelin Inge. „Eigentlich bin ich zu euch gekommen, um Ruhe zu haben“, brummte der Freund beim Betreten des Erdbunkers. Kaum war auch Jan de Vreeze im Erdloch verschwunden, die Falltüre noch in der Hand, da erwischte sie die Druckwelle einer auf den Hühnerstall niedergegangenen und detonierten Bombe. Sie riss den Großvater die Falltüre aus der Hand, er aber blieb gottlob unverletzt. |
Rund ein halbes Dutzend Bomben seien in den folgenden Minuten aufs Feld gefallen und detoniert. Ein gezielter Angriff schien es nicht gewesen zu sein, wahrscheinlicher ist es, dass die Bomber nur ihren Ballast abwerfen wollten, um schneller aus der Reichweite der Flaks zu kommen. Denn weder die nahen Bauernhäuser noch Wohnbauten waren getroffen, lediglich das kleine irgendwie im Weg stehende Wohnhaus der de Vreezes erlitt Schaden. Und wirklich – die Druckwelle hatte das Dach des Wohnhauses abgedeckt, die Fenster waren zersprungen, Schutt und Asche lag auf den Daunenbetten, der Kartoffelsalat war ungenießbar geworden. Aber wie durch ein Wunder waren nicht einmal die Hühner zu Schaden gekommen, durch den Luftdruck waren sie lediglich umhergewirbelt worden. Bis zur Hüfte eingeklemmt Dieses Glück war Inge Litschke nicht hold. Schon wochenlang lag Dinslaken unter Artilleriebeschuss. Die Menschen waren es in den letzten Wochen des Krieges gewöhnt, von jetzt auf gleich die Schutzkeller aufzusuchen. So auch die 14-jährige Inge Litschke, die zusammen mit den Brüdern und den Eltern auf der Schlepperstraße lebte. Am Mittag des 22. Januar 1945 war es wieder einmal so weit – Luftalarm, Schutzsuche im Keller. „13 Personen waren wir mit den Nachbarn“, erinnert sich Inge Litschke, als die Bombe einschlug und das Haus samt Keller in Schutt und Asche legte. Bis zur Hüfte eingeklemmt saß das junge Mädchen in den Trümmern, tastete in der Dunkelheit mit den Händen die Wände ab, bis sie die Hand ihrer Mutter fand. „Sie war noch warm“, erinnert sich die heute 89-Jährige. „Dan aber wurde sie kalt und ich wusste, meine Mutter war tot.“ Leichte Verletzungen Zwei Stunden harrte Inge Litschke dort unten aus, bis von oben Stimmen ertönten und Schutt beiseite geräumt wurden. Das erste, was das junge Mädchen sah, war das Licht einer Grubenlampe. Und schließlich der Ruf: „Inge, wir holen Dich raus.“ Nur zwei Personen sollten die hilfreichen Nachbarn lebend bergen: Inge Litschke und die Schwiegertochter eines der Nachbarn. Litschke trug beim Bombenangriff nur leichte Schürfverletzungen an den Beinen davon und Brandwunden am Kopf. Seltsamerweise waren es aber keine Brandbomben, die gefallen waren, doch später erzählte man ihr, die Brandwunden wären durch die Hitzeeinwirkung der Explosion entstanden. Das junge Mädchen hatte ihre komplette Familie verloren. Auch den Vater, der eigentlich schon auf der Zeche hätte sein müssen, wenn er nicht den Sohn in den Schutzkeller getragen hätte. Luftangriffe unterbrachen Beerdigungen 85 Menschen fanden an diesem 22. Januar in Lohberg den Tod und selbst ihre Beerdigung konnte nicht reibungslos vonstatten gehen, auch hier wurde die Zeremonie von Luftangriffen unterbrochen. Es sollten nur die Vorboten einer viel größeren Zerstörung sein. Zum 23. März 1945 folgt ein weiterer Bericht.
|
|
Der 23. März 1945 war Dinslakens schwarzer Freitag Birgit Gargitter, NRZ 30.03.2020
Bei dem Angriff der Alliierten am 23. März 1945 wurde die Dinslakener Innenstadt zerstört. Foto: Stadtarchiv Dinslaken 511 Menschen fanden beim Bombenangriff der Alliierten den Tod. 80 Prozent der Stadt wurden zerstört – darunter auch die St.-Vincentius-Kirche. Es war ein heller wolkenloser Tag, ein wunderschöner Frühlingsmorgen. Der Krieg schien an diesem Morgen fern zu sein, Frauen nutzten den Morgen, um sich und ihre Familien mit den nötigsten Lebensmitteln zu versorgen. Es war die Ruhe vor dem Sturm, an jenem Frühlingsmorgen des 23. März, der ein schwarzer Freitag für Dinslaken werden sollte. Mit enormem Materialaufwand nahmen die Alliierten den Angriff auf die Hauptkampflinie Rhein vor. Seit Monaten waren die Dinslakener Luftangriffen, Geschützdonner und Tage zuvor dem Artilleriebeschuss ausgesetzt. Ohne Vorwarnungen brach es über Dinslaken hinein Doch der 23. März 1945 sollte zu einem Inferno werden. Ohne Vorwarnungen, die ersten Bomben hatten wohl die Stromzufuhr zu den Sirenen unterbrochen, brach es über Dinslaken herein. Der damals neunjährige Hermann Hagenacker hatte vom Rutenwall aus drei Flugzeuge am Himmel bemerkt. Nichts Ungewöhnliches in diesen Tagen. Er schreibt dazu in Friedhelm van Laaks Buch „Erleben und Überleben“: „Aber auf einmal ist alles ganz anders. Noch bevor es passiert, fängt die Luft an zu sirren und schwingen. Ein eisiges Gefühl von Gefahr verbreitet sich. Und dann die ersten Einschläge, mitten in der Innenstadt. Wir sind dran!“ Im Schutzkeller fing der Junge an zu beten. „Mein Gott, muss ich jetzt sterben? Ich bin doch noch so jung. Das kannst Du doch nicht wollen. Lass mich am Leben. Ich habe doch nichts Böses getan. Lieber Jesus, hilf mir doch. Ich habe solche Angst.“ Änne Lettgen sah von ihrer Haustür aus hinter der Villa Wienert schwarze Rauchwolken aufziehen. Zuerst hielten sie und ihre Mutter es für ein Gewitter, dann aber fiel es Änne Lettgen wie Schuppen von den Augen: „Mama, sie kommen“, rief sie aufgeregt. Doch die Mutter blieb ruhig: „Das kann nicht sein. Ich habe gerade erst die Fenster geputzt...“ Doch das war den Amerikanern wohl egal. |
Kaum jemand störte sich an öffentlicher Luftwarnung am Morgen Emmy Remberg überlebte den Angriff im Kreishaus. Am Morgen des 23. März hatte ihre Mutter sie vergeblich gebeten, nicht zur Arbeit zu fahren. Emmy Remberg war damals Kontoristin im Geschäft für Bürobedarf Wiber. Ihr Pflichtgefühl ließ es nicht zu, an diesem Tag zu Hause zu bleiben. „Bei Mess am Neutor“, berichtet sie 1995 in der NRZ über die Geschehnisse des Schwarzen Freitags, „war es schwarz vor Menschen. Es hatte eine Lieferung Speiseöl gegeben. Obwohl gegen acht Uhr morgens eine öffentliche Luftwarnung geblasen worden ist, störte sich kaum jemand daran, es war ja an der Tagesordnung.“ Doch schon die ersten Angriffe hatten den Neutorplatz getroffen und mit ihm das Geschäft „Otto Mess“. Alle Kunden und auch die Angestellten und die Chefin der Mess-Filiale starben. Lediglich Irma Henning überlebte und fühlte sich noch Jahre danach schuldig. Sie absolvierte gerade ihre Lehre im Geschäft. Oft gab die Chefin ihren Angestellten Lebensmittel mit für die Familien daheim. So auch am Abend des 22. März. Ein paar Flaschen Wein, Zucker und andere Lebensmittel brachte Irma Henning mit zu ihren Eltern. Eine Flasche Wein jedoch behielt sie für sich. „Es war doch der erste Wein meines Lebens“, sagte sie. Er rettete ihr das Leben, denn nach dem Genuss ihres ersten Alkohols fühlte sie sich am anderen Morgen sterbenskrank und blieb daheim. Rauchwolken lagen über der Stadt Von Walsum aus sah sie die Bomber gen Dinslaken fliegen, sah die Rauchwolken über der Stadt. Erst später erfuhr sie vom Tod ihrer Kollegen. Inge Litschke unterdessen irrte mit ihrer Tante und dem Vetter in Lohberg umher. „Wir rannten einfach aus der Siedlung hin zur Kohlenwäsche“, erzählt sie. „Dort arbeiteten Verwandte, die von einem Stollen berichtet hatten. Der Meister der Kohlenwäsche, ein Herr Kaiser, soll ihn in den Oberlohberg gegraben haben zum Schutz.“ Zwischen den Schienen der Werksbahn trafen sie auf einen Mann, der sie anfauchte, wohin um alles in der Welt sie denn wollten. „Wir hatten Glück, den gesuchten Mann gefunden zu haben, der uns mit in seinen Stollen nahm, eigentlich eher ein größerer Unterstand. Aber wir überlebten.“ Bandeisenwerk im Fokus 511 Menschen jedoch fanden bei den Angriffswellen in Dinslaken den Tod, fast 80 Prozent der Stadt wurde zerstört, darunter auch die St.-Vincentius-Kirche und das katholische Krankenhaus. Eine zweite Angriffswelle am Mittag hatte vorrangig dem Bandeisenwerk gegolten. Die amerikanische Beschreibung jenes Tages lautet folgendermaßen: „Der deutsche Verkehrsknotenpunkt von Dinslaken, eine stahlproduzierende Stadt am Rhein nördlich der Ruhr, wurde am 23. März 1945 von mittelschweren und leichten Bombern der 9. Bomberdivision brennend hinterlassen. Straßenzüge, Eisenbahnlinien und weitere Schwerpunkte wurden getroffen, um die feindliche Verteidigung für den alliierten Angriff über den Rhein zu schwächen.“ Am 24. März marschierten die Amerikaner in Dinslaken ein. |
|
„Hundertmal Glück“: Wie ein Soldat das Kriegsende erlebte Jaap Robben, NRZ 22.03.2020
Hochwasser und Schlamm erschwerten den Alliierten das Vorrücken in Richtung Kleve. Das Foto zeigt überschwemmtes Gebiet bei Kranenburg. Foto: NRZ KREIS KLEVE/ESSEN. Walter Holona war vor 75 Jahren als Wehrmachts-Soldat in Kranenburg. In einem eindringlichen Gespräch erzählt er von seinen Erinnerungen. Nach dem Aufruf an Augenzeugen der Offensive im Rheinland erhalte ich einen handgeschriebenen Brief. In der gepflegten, etwas zittrigen Handschrift eines 96-Jährigen schreibt Herr Holona über seine Vergangenheit als Soldat der 95. Infanterie-Division 280 der Wehrmacht. Über Russland und Frankreich gelangte er letztendlich nach Kranenburg. Dort erlebte er die Erstürmung durch die Amerikaner. „Leider kann ich das alles nicht dokumentieren, aber erzählen könnte ich viel“, schreibt Holona in seinem Brief an mich. Die Befreiung aus der Sicht eines Wehrmachtssoldaten – darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Vor zwanzig Jahren, im Geschichtsunterricht in den Niederlanden, lernte ich über die Befreiung eigentlich nur aus der Sicht der Alliierten. Von Wehrmachtssoldaten waren nur ein paar Fotos neben dem Text zu sehen. Meist als Kriegsgefangene, Juden verfolgend oder tot in einem Graben. Namenlose, austauschbare Figuren, die wegen des Hakenkreuzes auf ihrer Uniform direkt alle Schuld an all der tiefsten Schwärze des Zweiten Weltkrieges zugewiesen bekamen. In den letzten Jahren hat sich dieses Bild nuanciert. Das Endes des Zweiten Weltkrieges ist eine vielschichtige Geschichte Ich rufe Herrn Holona an. Seine herzliche, laute Stimme lädt mich sofort zu sich nach Hause ein. Zwei Tage später fahre ich in einen Vorort von Essen. Unterwegs denke ich immer wieder an den einen Satz in seinem Brief, in dem er schreibt, dass er nichts dokumentieren kann. Inwieweit kann man einer Vergangenheit, wovon es keine Dokumentation gibt und die auf einseitigen Erinnerungen basiert, vertrauen?
Jaap Robben im Gespräch mit Walter Holona. Foto( André Hirtz Es ist nicht so, dass ich Herrn Holona nicht vertraue, aber diese Geschichte ist so vielschichtig, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Man kann nicht einfach nur über das Ende des Zweiten Weltkriegs reden, ohne auch den Rest zur Sprache zu bringen. Aber wie kann man in anderthalb Stunden die schrecklichsten, komplexesten und intensivsten Jahre im Leben eines Menschen besprechen? Worüber sollte ich weiterfragen, ohne dass es wie ein Polizeiverhör wirkt? Was weiß ich überhaupt darüber? Ich parke mein Auto und betrachte den Häuserblock. Ich denke darüber nach, dass Herr Holona seinen Brief selbst geschickt hat. Dass er wahrscheinlich gerne reden möchte. Vielleicht sollte ich erst mal damit beginnen, zuzuhören. Schon bevor wir uns an seinen Esstisch setzen, fängt er an zu erzählen. „In Kranenburg war niemand mehr. Ich saß mit einigen Soldaten im Keller des Tierarztes. Dort haben wir etwas zu essen gefunden. Und Laken, mit denen wir einen Schlafplatz gemacht haben.“ Die Worte kommen hastig aus seinem Mund, als wären sie zu lange eingesperrt gewesen. Manchmal sagt er mitten in einer Schilderung: „Oh ja, das muss ich auch erzählen.“ So springen wir von der Normandie in die klirrende Kälte der Ukraine, über Kranenburg zurück nach Essen. Viele Geschichten enden mit: „Ich hatte hundertmal Glück.“ Jenes Mal, als er weggerufen wurde und eine Granate genau dort in der Kolonne explodierte, wo er gerade noch marschiert war. Oder ein anderes Mal, als er mit einem verheirateten Soldaten in einem Bunker saß. Dieser Mann hatte Kinder, also musste Holona hinausgehen, um eine Botschaft zu überbringen. Kurz danach fiel eine Bombe auf den Bunker. „Ich hatte hundertmal Glück.“ Das fühlt sich bitter an, denn neben Holonas Glück sprechen wir nicht über jene anderen Soldaten. Junge Männer, die seit mindestens fünfundsiebzig Jahren unter grauen Grabsteinen liegen. Erinnerungen an Reibekuchen in Kranenburg „Haben Sie schon mal Reibekuchen gegessen?“, fragt er plötzlich. „Äh...“, stottere ich. „Mit Kakaobutter?“ „Werden Sie den jetzt zubereiten?“ „Nein, nein.“ Er lächelt breit. „Den haben wir in Kranenburg gemacht. Wenn man ihn schnell gegessen hat, war er ganz in Ordnung. Aber wenn man zu lange gewartet hat, wurde er ungenießbar.“ Mir ist klar, dass sich seine Geschichten in den letzten fünfundsiebzig Jahren von Erlebnissen zu Erinnerungen und dann zu bündigen Anekdoten gewandelt haben müssen, die immer mit einem Lächeln und mit „Ich hatte hundertmal Glück“ enden. „Aber Sie waren achtzehn Jahre alt, als Sie eingezogen wurden“, unterbreche ich ihn. „Und zweiundzwanzig als der Krieg vorbei war. Sie müssen in jungen Jahren schreckliche Dinge erlebt haben.“
Deutsche Soldaten zwischen Kranenburg und Kleve auf dem Weg in die Gefangenschaft. - Foto: Privat Es wird still, sein Gesicht trübt sich.„Ich habe den Krieg gehasst, auch den Kadavergehorsam. Aber was konnte ich allein schon ausrichten?“ Unruhig schieben seine Hände den kleinen Zettel, auf den er drei Anekdoten gekritzelt hat, hin und her. „Ich weiß noch, wie ein Obergefreiter einmal zwei russische Soldaten in einem Brunnen fand, mit erhobenen Händen. Ohne zu zögern schoss er ihnen in den Kopf. Ich war der einzige, der daneben stand. Wenn ich etwas gesagt hätte, wäre ich auch erschossen worden. Das Schwein, ich kenne seinen Namen noch immer.“ Ich zögere, ob ich nach diesem Namen fragen soll. Er nennt ihn mir und buchstabiert ihn langsam, damit ich es richtig aufschreibe. Walter Holona: „Ich wollte ein guter Mensch sein“ „Wir kamen im Osten einmal in einen dunklen Keller.“ Seine Hände halten ein unsichtbares Gewehr. „Ich fühlte, dass ich auf etwas Weiches trat. Da lag ein Mensch, ich stand auf einem toten Menschen. Schrecklich.“ Seine Hände verscheuchen die Erinnerungen. „Das wollen die Leser doch alles gar nicht wissen?“ |
„Haben Sie selbst Menschen getötet?“ Holona nickt, ohne zu zögern. „Ich habe mein Leben lang versucht, ein guter Mensch zu sein, aber die Armee zwingt einen zum Bösen, um zu überleben. Eigentlich gibt es in der Armee keine Eigenständigkeit. In Russland wurden wir von einer unglaublich großen Gruppe Russen angegriffen. Der Horizont war voller Soldaten, die schießend auf uns zu stürmten. Da habe ich auf jeden geschossen, den ich treffen konnte. Es tut mir leid, dass ich getötet habe, aber ich wollte überleben.“ Das Gespräch wendet sich den Amerikanern zu, die aus den Niederlanden in Richtung Kleve zogen. „Ich war der letzte deutsche Soldat, der noch in Kranenburg war. Ich sah die Amis mit ihren Gewehren über der Schulter vorbeilaufen.“ „Hat man Sie zu einem Kriegsgefangenen gemacht?“ „Erst später. Zuerst rannte ich zu einem Bunker in Nütterden zurück, aber mein Feldwebel war schon lange weg. Also bin ich vor den Amis nach Kleve geflüchtet.“ Auf ein Blatt Papier zeichnet er drei Bauernhöfe, in denen er sich kurz versteckt hat. Das muss in Donsbrüggen gewesen sein. „In Kleve schlug eine schwere Bombe direkt neben mir ein.“ Holona schweigt und sieht mich fragend an, er erwartet, dass ich etwas sage. „Hundertmal Glück?“, versuche ich. Er nickt, aber lächelt nicht mehr dabei. „Stundenlang habe ich mich dort in einer Grube versteckt.“ „Und danach?“ „Dann fand ich meine Einheit wieder. Wir zogen uns zurück. Wir waren den Amis immer drei Tage voraus. Letztendlich wurden wir, zweihundertfünfzig Mann, in Wesel eingekesselt. Dort mussten wir hart kämpfen. Ich habe versucht, in der Mitte der Gruppe zu bleiben. Fast alle um mich herum waren tot, auch Kumpels.“ „Haben Sie jemals ihre Gräber besucht?“ „Oh, mein Gott, nein. Sicherlich nicht in Russland. Manchmal hörte ich ihre Namen und dann wusste ich, oh ja, das war der und der. Wir gingen einmal mit achthundert Mann in einen Schützengraben. Achtzig kamen wieder raus.“ Er schüttelt den Kopf. „Ich kann immer noch sehen, wie ihre Köpfe zur Seite fielen, als sie starben. Oder als sie in den Kopf geschossen wurden. Dann sieht man so dumm aus wie ein Fisch.“ In Belgien gibt es einen der größten deutschen Kriegsfriedhöfe Letztes Jahr war ich wegen einer anderen Reportage im belgischen Ort Lommel auf einem der größten deutschen Kriegsfriedhöfe außerhalb Deutschlands. Mehr als 39.108 graue Kreuze in Reih und Glied. Der Gärtner, der das Gelände pflegte, erzählte mir, dass es kaum Besucher gab. Bei einigen wenigen Gräbern hingen verregnete Kränze. Diesen Toten wird so grau wie möglich gedacht. An den Gräbern selbst kann man nicht erkennen, wer probiert hat, gut zu bleiben, um zu überleben, und wer sich wie ein Schwein benommen hat. „Haben Sie in Ihrem Leben oft über diese Sachen gesprochen?“ „Nein, nicht wirklich. Mein Schwager war in einer anderen Einheit. Dann redete man mal darüber, wo man gewesen war. Und wann. Dann wusste man genug.“ „Und mit den Nachbarn?“ „Meinen Nachbarn?“, lacht er. „Die sind alle erst Anfang achtzig, die haben nichts durchgemacht. Und Frauen wissen auch nicht, wie es war.“ „Und Ihre Kinder?“ „Tja, meine Kinder.“ Er lächelt liebevoll zu den Bildern auf der Kommode hin. „Sie wissen ja alle viel besser als ich, wie es damals unter Hitler war.“ „Hatten Sie bei der Ankunft der Amerikaner das Gefühl, dass Sie kapitulierten, oder war es eine Befreiung?“ „Eine Befreiung! Sonst hätte ich noch zwanzig oder dreißig Jahre meines Lebens Soldat bleiben müssen.“ „Aber Sie haben mir gerade erzählt, dass Sie auch noch Kriegsgefangener gewesen sind.“ Nach dem Krieg wurde Walter Holona ein Holzhändler „Das war erst nach Bielefeld.“ Er seufzt. „Dort wurden wir in Viehwaggons getrieben, siebzig oder achtzig Mann pro Waggon. In Deutschland ging das ja noch, aber die lieben Feinde, die lieben Belgier, warfen glühende Kohlen herein. Sie schmissen Schwellen von den Brücken in unseren offenen Waggon. In Namur mussten wir eine Weile laufen, dort wurden wir von Zuschauern getreten und geschlagen. Oft auch mit Stöcken. Ich habe versucht, in der Mitte der Gruppe zu bleiben. Wir durften uns nicht wehren. Ich verstand, dass sie wütend auf uns waren, aber es war... schrecklich.“ „Wie war die Situation im Kriegsgefangenenlager?“ „Sie waren überhaupt nicht auf die Ankunft von Tausenden von Männern vorbereitet. Es gab einen Mangel an allem. Nichts, worunter man schlafen hätte können. Am Anfang fielen wir oft vor Erschöpfung und Hunger um. Wir bekamen einen halben Liter Suppe, den wir zu sechst teilten, das war Wasser mit Kartoffelschalen. Tagsüber haben wir schwere Arbeit geleistet. Oft mussten wir uns gegenseitig aufhelfen, weil wieder jemand umgefallen ist.“ „Wie haben die Amerikaner Sie behandelt?“ „Es ging. Aber manchmal mussten wir irgendwohin marschieren und dann schossen sie auf uns. Einfach so. Wir waren Kaninchen, auf die sie schießen konnten. Ich war ein paar Monate dort. Völlig unerwartet durften immer wieder Gruppen nach Hause.“ „Wussten Sie, was in den deutschen Konzentrationslagern geschehen war?“ „Das haben wir erst später gehört. Ich wusste, dass es Lager gab, aber ich dachte, die wären nur für Arbeit.“ „Haben Sie selbst bei der Verfolgung von Juden geholfen?“ „Nein, mein Gott, nein.“ Er schüttelt immerzu den Kopf. „Nein, niemals.“ Nachdem ich meine Jacke angezogen habe, stehen wir noch eben in seinem Wohnzimmer.„Wie war es, endlich wieder nach Hause zu kommen?“ „Es musste Geld verdient werden, ich habe meine Ausbildung fertiggemacht und wurde Holzhändler. Ich bin ihr begegnet, wir sind siebzig Jahre lang verheiratet gewesen.“ Er zeigt auf das Foto seiner verschiedenen Frau. „Ach“, seufzt er. „Ich bin doch für niemanden interessant? Es war einfach nur ein Leben.“ Der Text wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Karin Preslmayr. Der Autor Jaap Robben war für die NRZ war der Grenzgänger anlässlich des Kriegsendes vor 75 Jahren jetzt am Niederrhein unterwegs. Dabei folgte er dem Weg der „Operation Veritable“, bei der die Alliierten die deutschen Truppen über den Rhein drängten.
Info: Das war die Operation Veritable AM NIEDERRHEIN. Mit den Militäroffensiven „Operation Veritable“ und „Operation Grenade“ nahmen die Alliierten im Februar 1945 die deutschen Truppen am Niederrhein in die Zange, drängten sie in Richtung Osten über den Rhein. Von Südwesten her trieben amerikanische Kräfte die „Operation Grenade“ voran, von Nordwesten kommend bildeten vor allem Briten und Kanadier die „Operation Veritable“. Die „Operation Veritable“ begann am 8. Februar 1945 im niederländischen Städtchen Groesbeek. Bei der Schlacht im Reichswald verloren binnen zwei Wochen mehr als 10.000 Soldaten und viele Zivilisten ihr Leben. Im Rheinfeldzug wurden die deutschen Truppen bis zum 10. März am Niederrhein vom westlichen Rheinufer vertrieben. Am 24. März 1945 setzten die Alliierten bei Wesel über den Rhein. |