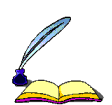

| Dinslakener Geschichte |
|
 |
|
Niederrheinisches Platt - Die Sprache unserer Heimat |
|
Der Niederrheiner spricht drei Sprachen: „Hochdeutsch“, „Plattdeutsch“ und „Überandereleute“. Hochdeutsch wird viel zu viel gesprochen und geschrieben, richtig und falsch. „Überandereleute“ soll man nicht reden. Plattdeutsch wird viel zu wenig gesprochen und noch weniger geschrieben. Nahezu vergessen ist die Zeit, als die plattdeutsche Sprache die einzige Sprache war in den deutschen Landen. Sie erklang am Königshof wie in der niederen Bauernkate. Es gibt verschiedene Gründe für das allmähliche Schwinden der plattdeutschen Sprache. Sie liegen zum Teil im Menschen selbst, andererseits aber auch in den sich wandelnden wirtschaftlichen Verhältnissen unserer Region. Mit Beginn der Industrialisierung und den Wanderbewegungen der Menschen hin zu den Industriestandorten, die Arbeit und Brot versprachen, wurde es immer wichtiger, sich schon allein der Verständigung wegen der Hochdeutschen Sprache zu bedienen. Sie bildete eine verbindende Brücke zu den unterschiedlichen Dialekten, die in den Deutschen Landen besprochen wurden und zum Teil auch heute noch gesprochen werden.
|
Das Plattdeutsche trat so immer mehr zurück, und wurde im
20. Jahrhundert oftmals als eine „gemeine“ und „gewöhnliche“ Sprache, eine „freche“
und „grobe“ Sprache, die Sprache der Bauern und Ungebildeten dargestellt.
Schade eigentlich. Das hat unsere „Muttersprache“ nicht verdient. Denn auch
unsere Niederrheinische Mundart bietet mit seinen Redensarten und
Sprichwörtern zu besonderen Begebenheiten und Gelegenheiten einen Reichtum
unserer Sprache. Hier einige Beispiele:
Zu einem „mageren“ Menschen sagt der
Volksmund: Und nun kommen die „Dicken“
dran: Der Kahlkopf muss auch oft herhalten im Volkswitz:
Auch über Essen und Trinken gibt es manch „coolen“ Spruch: |
|
Een, twee, drij …- plattdeutsche Zahlenkunde
Im Plattdeutschen bedient man sich bei der Aussprache von Zahlen nicht der hochdeutschen Sprache, sondern der Muttersprache entsprechenden Ausdrucksformen. Hier die gebräuchlichsten Zahlen: Eins bis zehn = een, twee, drij, vier, fiff, sass, sewen/söwen, ach, neegen, tien. Elf bis zwantig= elf, twälf, dättien, vättien, fifftien, sässtien, sewentien/söwentien, achtien, neegentien, twenteg. Dreißig bis hundert = dättig, vättig, fiffteg, sässteg, sewenzeg/söwenzeg, achzeg, neegenzeg, hondert. Die „Vier“ nimmt in der Einer-Reihe eine Sonderstellung ein, da sie als einzige Zahl geschrieben und gesprochen wird wie im Hochdeutschen. Die „Elf“ wird zwar genau so geschrieben wie im Hochdeutschen, jedoch wir das „e“ gelängt ausgesprochen wie in dem Namen „Meta“. Bei den Zahlen mit „Sieben“ findet man zwei unterschiedliche Schreibweisen „sewen“ und „söwen“. In der Aussprache ist dieser Unterschied jedoch nicht immer zu merken, da der erste Selbstlaut oftmals zwischen „e“ und „ö“ ausgesprochen wird. |
Gedicht:
Dat olle Platt Dat olle Platt, Gerda Heselmann |
|
Geschichten und Andekdoten in plattdeutscher Sprache haben ihren eigenen
Reiz. Hier einige Beispiele:
Die Beschwerde |
Sprechen mit Kopfstimme "Dat woll eck noch seggen", sagte der Bauer, der nicht gerne viele Worte machte, zu seinem Knecht, "wenn eck soo maak" - und dabei warf er den Kopf etwas nach hinten - "dann hät dat sovöll wie: komm mal her!" "Jo, jo, dat es gut", sagte der Knecht, "dat es ock minne Art, wenn eck dann soo maak" - und er schüttelte mit dem Kopf - "dann het dat sovöll wie: eck komm niet!" |
|
Was bedeuten "Hoolleijen, Tupaat, Schöngelbrot"
? Kaum einer kennt diese Begriffe noch. Denn auch in der Mundart gibt es Wörter die ausgestorben sind, weil die Dinge oder Handlungen, denen sie den Namen gaben, nur noch in Museen oder Volksspielen vorkommen. Ein "Hool" hing früher, wie man heute noch in der Küche des Museums Voswinkelshof sehen kann, als sägenförmiges Ding über dem offenen Herdfeuer. Daran hingen die eisernen Kochtopfe, die mit der "kalten Hand" höher oder tiefer geschoben wurden. Trat nun am Martinstag ein Dienstmädchen seine Stellung an, so nahm die Bäuerin die neue Hilfe an die Hand und "leijte" (führte) sie um die Feuerstelle, also um das "Hool" herum; daher der Begriff "Hoolleijen". Damit war die "Mag" in die Hausgemeinschaft aufgenommen.
|
Der Lohn war vorher beim "Vermijen" (Vermieten) zwischen der Bäuerin und der Mutter des Mädchens ausgemacht worden. Dabei hatte die Bäuerin der Magd einen "Mietsdaler" (Mietataler = Anzahlung) in die Hand gedrückt. Zu dem Barlohn gab es noch einen Zuteil ein "Tupaat" in Form eines Kleides, Rockes oder einer Schürze. Wir würden dies heute als Sachzuwendung bezeichnen. Die Bäuerin hatte selbstverständlich für die Magdmutter "de Koffie gekok" und die neue Magd konnte durch Zupacken beim "Opdeschen" (Auftischen) zeigen, "af in de Deern wat drinsett!" (das in dem Mädchen was drinsteckt). War nun alles gereget, bekam die Mutter des Mädchens von der Bäuerin ein frisch gebackenes Brot zum Abschied, das sie unter dem Arm nahm und damit nach Hause "schöngelte" (langsam gehen). Das war das "Schöngelbrot". |
|
Das rabenschwarze Heidenkind – eine Anekdote aus der Altstadt Als nach dem ersten Weltkrieg die Belgier Dinslaken besetzt hatten, gab es häufig kleinere Streitigkeiten mit den fremden Soldaten. Eines Tages wurde die Kompanie Wallonen abgelöst, und es rückte eine flämische Einheit in die Quartiere. Im zweiten Glied marschierte auch ein schwarzer Kolonial-Soldat, ein richtiger Neger. Wenn er auf Posten stand, war er ständig von Kindern umlagert. Kinder konnte er übrigens gut leiden. Dafür packte er die Erwachsenen, wenn sie ihm in die Quere kamen, etwas rauher an. Damals mussten die Gaststätten schon um 10 Uhr geschlossen werden. So hatte es der Ortskommandant angeordnet. An einem Samstagabend aber stand um einhalb elf Uhr noch eine ganze Korona im Dinslakener Hof an der Theke. Plötzlich erschien eine belgische Streife auf der Bildfläche und begann mit rauher Hand die Gäste auf die Straße zu befördern. Unter den Soldaten war auch der Neger. Der hatte gleich den Dores (Theo) am Kragen und schob ihn etwas unsanft ins Freie. Das hätte der Dores noch gelten lassen, dass der Schwarze ihn aber das frisch gezapfte Bier nicht austrinken ließ, das brachte den alten Dinslakener zum Sieden. Plötzlich sah er nicht mehr schwarz, sondern rot. Er packte den Neger vorn am Uniformrock und schüttelte ihn, während er dem Sohn des Kongo laut und deutlich seine Meinung sagte. Zwei Kameraden kamen dem Schwarzen zu Hilfe. Dores wurde mit zur Wache genommen. Dort musste er den Hergang erzählen. Zum Glück war der Offizier ein Flame. Als dieser Begriff, was geschehen war, konnte er sich das Lachen nicht verkneifen. Dores wurde entlassen.
|
„Mensch, Dores, wie hast du das geschafft?“ Gerührt empfingen sie den armen Dores. „Was hast du eigentlich mit dem schwarzen Kerl gehabt?“ „Ja, Kinder, passt mal auf, als ich den Mohr am Schlips hatte und der mich mit seinen dicken weißen Kulleraugen anhimmelte, da hab‘ ich dem folgende gesagt: Du verdammter Kerl, hab‘ ich gesagt. Du rabenschwarzes Heidenkind. Früher hab ich in der Schule für dich Silberpapier gesammelt, damit du in den Himmel kommst und jetzt lässt du mich nicht mal das letzte Bier austrinken. Schäm‘ dich!“ von Hubert van Loosen im Heimatkalender Kreis Dinslaken |
|
Volkstümliche Bräuche in der Karwoche Die kirchlichen Feste sind von jeher Mittelpunkt des heimatlichen Brauchtums gewesen. Teilweise haben sich diese Gebräuche noch bis in die Gegenwart hinein erhalten. Viele andere sind schon aus dem Bewusstsein des Volkes verschwunden. Das noch Vorhandene aber treulich, zu erhalten, muss unsere vornehmste Aufgabe sein. Schon Anfang des vorherigen Jahrhunderts hat der Rektor Wilhelm Teebrüggen für Dinslaken in dieser Hinsicht wichtige Vorarbeit geleistet. Nach dem Gedächtnis seiner hochbetagten Mutter schrieb er Lieder und Sprüche aus der Dinslakener Gegend nieder und hat dadurch vieles vor dem endgültigen Vergessen bewahrt. Namentlich die Karwoche mit dem folgenden Osterfest war von vielen alten Gebräuchen umrankt. Am Palmsonntag brachten die Leute einen am oberen Ende in mehrere Teile gespaltenen Stock, der mit Buchsbaum verziert und häufig mit Hefegebäck in der Form von Vögelchen, Pille Enten oder Pille Gänskes und Möschen behangen war, in die Kirche, um dort den Buchsbaum weihen zu lassen. Nicht selten hingen Ketten von Pflaumen und Rosinen rundum. Nach dem Gottesdienst wurden die Buchsbaumzweige ("de Palm") in die Stallungen, In das Wohnhaus und in den Acker gesteckt, um Segen für das Haus und gute Ernte zu erbitten. Dabei sagte man den Spruch: "Eck stäk en Pälmken op Poßdag, Das Backwerk des Palmstockes erhielten die Kinder zum Geschenk. Sie trugen ihn auf den Straßen umher und sangen:
|
"Palm, Palm, Possen, Heikorei! Am Gründonnerstag 'war es bei den Hausfrauen Sitte, eine meistens aus sieben Grünkräutern bestehende Suppe zum Mittagsmahl aufzutischen. Am Karfreitag, am "guje Fridag", schwiegen die Glocken nach katholischer Sitte. "Sie fliegen nach Rom", sagten die Kinder. "Hast van Naach de Glocke gesien? An Stelle der Glocken tritt jetzt die hölzerne Klapper; mit der früher die Chorknaben und Kinder auch über die Straße zogen. Wer in der Karwoche einen Spaziergang unternimmt, sieht allerorten sich fleißige Hände regen, die wie in alten Zeiten auf den Ackern oder in der Nähe der Häuser Reisighaufen aufschichteten, die zu Ostern als Osterfeuer verbrannt werden. |